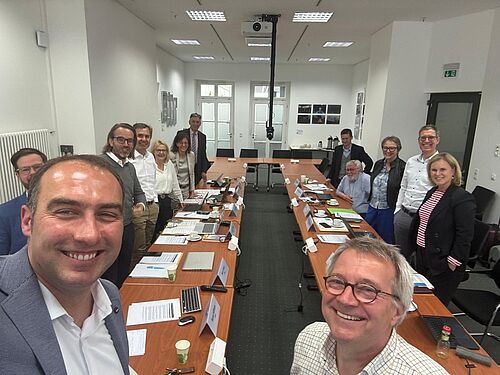Neuere Untersuchungen zeigen, dass der Rechtsruck in der jüngeren Wählerschaft dort besonders stark ist, wo er mit dem Gefühl des ausgegrenzt sein und der Marginalisierung einhergeht. Bezogen auf die berufliche Bildung lässt sich dies auch im Unterschied zur akademischen Bildung aufzeigen (Busse 2025).
Prof. Dr. Kaiser verdeutlichte diesen Zusammenhang am vergangenen Freitag (16.5.2025) anlässlich einer Arbeitsgruppensitzung des Pakts für berufliche Schulen der Kultusministerkonferenz (KMK) in Berlin. Der Pakt, eine gemeinsame Initiative der KMK und des Bundesministeriums für Bildung und Forschung, will die beruflichen Schulen zukunftsfähig aufstellen und deren Bildungs- und Integrationsleistung in der öffentlichen Wahrnehmung stärken. Nicht erst durch die jüngsten Ereignisse und Hinweise auf Rassismus an beruflichen Schulen ist hierbei die Stärkung der Demokratie in der beruflichen Bildung Thema geworden, eine eigene Arbeitsgruppe des Pakts mit der Entwicklung von konkreten Empfehlungen zu dieser Thematik zu beauftragen. Mitbeteiligt sind hier Bund, Länder, Verbände und Sozialpartner unter der Leitung der KMK.
In seinem Impulsreferat (s. Folien) betonte Herr Prof. Kaiser die Anerkennung als Schutz vor Gewalttätigkeit, Radikalisierung und menschenverachtendem Verhalten. Er sieht einerseits das besondere Potential der beruflichen Bildung, weil hier relativ unmittelbar Fähigkeiten des eigenen Beitrags zum gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Handeln erlebt werden können. Andererseits besteht die Notwendigkeit besonderer Anstrengungen in der beruflichen Bildung, um sie aus dem hierarchischen Verhältnis von Meister – Lehrling, des Führens und Dienens zu einem demokratischen Miteinander zu entwickeln. Hierzu zeigte er strukturelle Entwicklungsbedarfe (Kompetenzorientierte Prüfungen zur Sozialkunde), Kooperation und Vernetzung der Schulen auf der Regional- und Bundesebene u.a. mit Schulen gegen Rassismus oder der neu gegründeten Fachstelle auf. Besonders betonte er Ansätze zur Demokratieförderung in der Aus- und Weiterbildung von Berufschullehrkräften, wie sie seit Jahren an der Universität Rostock durch inhaltliche Schwerpunkte aber auch methodische Gestaltung der Ausbildung praktiziert werden und dort auch im Netzwerk für Demokratie und Bildung des landesweiten ZLB diskutiert und verbreitet werden.
Am Freitag in Berlin sah sich insbesondere das Bundesinstitut für Berufsbildung bei seinen neuen Initiativen zur Demokratieförderung bestärkt, aber auch bei den Ländern und dem Bund stießen die praxisorientierten Impulse auf Interesse und erzeugten den Wunsch, die Anregungen in die anschließenden Beratungen aufzunehmen.
Wissenschaft und Forschung an der Universität Rostock zeigt sich so einmal mehr in Verbindung mit Lehre und Politikberatung. Am Institut für Berufspädagogik in der Philosophischen Fakultät hat die Förderung einer auf den Menschen ausgerichteten Berufsbildung seit seiner Gründung einen besonderen Schwerpunkt.